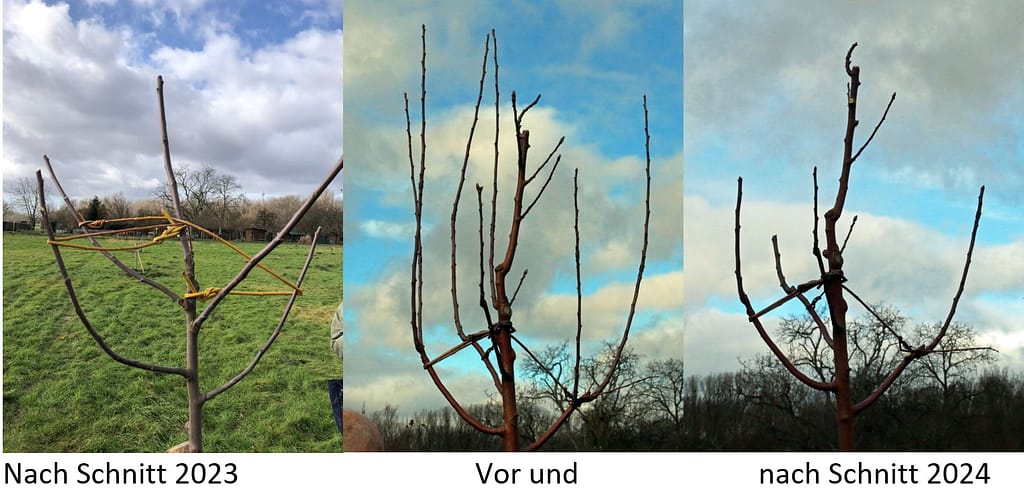Die Berufsbildende Schule Wirtschaft 2 in Ludwigshafen hatte Schüler aus befreundeten Schulen aus den Niederlanden und Spanien zu einem Nachhaltigkeitstag eingeladen. Die Schüler im Alter von 15-17 Jahren absovieren im Rhein Neckar Raum an drei Tagen verschiedene Projekte zu Nachhaltigkeitsthemen wie Energieeinsparung, CO2– Vermeidung aber auch Naturschutz und Biodiversität.
Nach der Anfrage zu einem Projekt bei unserer Bürgerinitiative, hatten wir die Idee die Jugendlichen fehlende oder eingegange Bäume auf der gemeindeeigenen Streuobstwiese pflanzen zu lassen. Die Gemeinde Altrip war sofort dabei und unterstütze die Aktion mit dem Kauf der Bäume und der Bereitstellung von Ausrüstung durch den Bauhof. Wir haben eine schriftliche Anleitung zum Pflanzen von Bäumen erstellt, die mit den Schülern vor dem Gang zur Streuobstwiese kurz durchgegangen wurde. Zuvor hatte Bürgermeister Mansky die Gruppe begrüßt und in Altrip willkommen geheißen.

Von der BIHN fanden sich einige Mitglieder zur Betreuung der Schüler bei den anstehenden Tätigkeiten. Diese hatten einen Schnellkurs zum Pflanzen von Bäumen gemacht und für Getränke und Snacks in Form von Apfelchips gesorgt. Herausfordernd war neben den sprachlichen Barrieren (dazu hatten wir Übersetzungshilfen erstellt) auch die Tatsache, dass viele der Jugendlichen zum erstenmal eine solche Tätigkeit durchführen sollten.
Unterstützt wurden wir von Rainer Rausch, (links im Bild), der ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet der Baumpflege ist und der auch für die Rheinpfalz Artikel im Bereich Natur schreibt. Er hatte die Bäume, die schließlich gepflanzt wurden, zuvor in der Baumschule ausgesucht.
Auf der Streuobstwiese gingen die Schüler dann anfangs skeptisch aber mit zunehmender Bergeisterung zu Werk. Innerhalb von ca. 3 Stunden waren die 8 Bäume gepflanzt. Es wurden auch Holzschilder mit Informationen zu den beteiligten Schulen angebracht, auf denen die Jugendlichen Ihre Namen schreiben konnten.





Aufruf an die Bürger: Nach dieser Aktion gilt es die Streubobstwiese weiter ganzjährig zu umsorgen, denn insbesondere längere Trockenperioden im Sommer setzen besonders den jungen Bäumen zu. Da werden Helfer gebraucht, die bei Gießaktionen mitmachen.

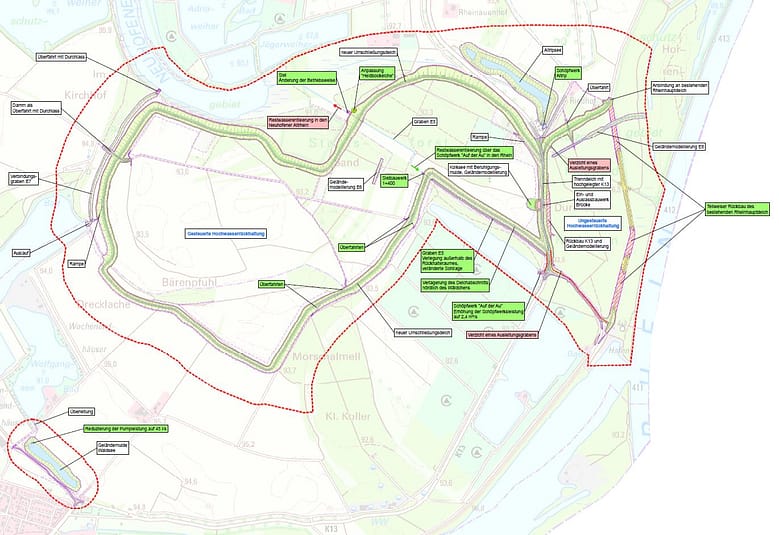



 Am 19.Sept 2024 kam Sie mit einer Gruppe von neun Kindern und ihren Kolleginnen Fr. Schaefer und Fr. Neher auf das Grundstück neben unserer Wiese ‚In der Teilung’.
Am 19.Sept 2024 kam Sie mit einer Gruppe von neun Kindern und ihren Kolleginnen Fr. Schaefer und Fr. Neher auf das Grundstück neben unserer Wiese ‚In der Teilung’. Bei ersten Beobachtungen aus respektvoller Distanz zur Bienenbeute, freute man sich über das emsige Treiben am Flugloch und über jede Biene die mit gelb- oder organge farbigem „Pollenhöschen“ angeflogen kam. Leider mussten wir auch die asiatische Wespe sehen, die in den Bienenstock eindringen wollte, aber glücklicherweise von den Wächterbienen erfolgreich abgewehrt wurde.
Bei ersten Beobachtungen aus respektvoller Distanz zur Bienenbeute, freute man sich über das emsige Treiben am Flugloch und über jede Biene die mit gelb- oder organge farbigem „Pollenhöschen“ angeflogen kam. Leider mussten wir auch die asiatische Wespe sehen, die in den Bienenstock eindringen wollte, aber glücklicherweise von den Wächterbienen erfolgreich abgewehrt wurde. Ausgestattet, mit Schleier, Schutzkleidung und Smoker wagten sich dann die ersten vor. In kleinen Grüppchen konnten sich nach und nach, alle davon überzeugen, dass mit Respekt vor dem Tier, mit Konzentration und ohne Hektik ein ganz ruhiges Arbeiten an der offenen Bienenbeute möglich ist.
Ausgestattet, mit Schleier, Schutzkleidung und Smoker wagten sich dann die ersten vor. In kleinen Grüppchen konnten sich nach und nach, alle davon überzeugen, dass mit Respekt vor dem Tier, mit Konzentration und ohne Hektik ein ganz ruhiges Arbeiten an der offenen Bienenbeute möglich ist.